Der optimale Praxisgrundriss: Strategisch planen und langfristig profitieren
Die Planung und Umsetzung eines optimalen Praxisgrundrisses ist komplex und maßgeblich für den langfristigen Erfolg jeder medizinischen Einrichtung verantwortlich. Ganz gleich, ob Ärzte ihre Praxis neu planen, gegenüber Investoren oder Architekten konkrete Anforderungen formulieren müssen, oder ob Architekten und Planer medizinische Flächen realisieren: Die Qualität der Entscheidungen in der frühen Planungsphase beeinflusst die Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Arbeitsqualität einer Praxis nachhaltig.
Dieser Artikel erläutert, was einen optimalen Praxisgrundriss ausmacht, zeigt typische Herausforderungen der Praxisplanung auf und verdeutlicht, welchen Mehrwert eine strategische und fachlich fundierte Herangehensweise bietet.
Ausgangslage – Unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen
Ein optimaler Praxisgrundriss wird aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich definiert:
- Investorensicht: Ziel ist meist eine maximale Rendite bei minimaler Investition.
- Ärzte und Praxisteams: Hier steht eine effiziente, praxisnahe Raumgestaltung im Fokus, bei der die Abläufe die räumliche Gestaltung bestimmen – nicht umgekehrt.
- Architekten und Planer: Verfolgen häufig kreative und individuelle Gestaltungsideen. Insbesondere Architekten, denen spezielle Erfahrungen im Gesundheitsbau fehlen, neigen dazu, ihre gestalterischen Ambitionen über funktionale und wirtschaftliche Anforderungen zu stellen.
Diese verschiedenen Zielsetzungen müssen frühzeitig klar kommuniziert und aufeinander abgestimmt werden, um Konflikte zu vermeiden.
Typische Herausforderungen in der Praxisplanung
Ein optimaler Grundriss erscheint auf dem „weißen Blatt Papier“ oft einfach und ideal. Doch gebäudespezifische und bauliche Faktoren erschweren eine objektive Bewertung, darunter:
- Kubatur und Grundfläche des Gebäudes
- Lage des Praxiszugangs und der Fensteranordnung (Tageslicht)
- Installations- und Versorgungsstränge
- Bauliche Vorgaben zu Flucht- und Rettungswegen
- Sonneneinstrahlung und Wärmebelastung
Werden diese Faktoren nicht frühzeitig berücksichtigt, entstehen oft Planungsfehler, die später nur schwer oder teuer korrigierbar sind.
Was macht einen Praxisgrundriss optimal?
Rund 70 % der Praxisräume sind standardisiert und folgen klaren gesetzlichen und technischen Vorgaben (Empfang, Wartebereiche, Behandlungszimmer, Sanitärräume).
Die verbleibenden etwa 30 % bestimmen jedoch maßgeblich Effizienz und Qualität der Praxis. Diese individuell variablen Räume hängen stark von folgenden Aspekten ab:
- Fachrichtung und Spezialisierung (z. B. OP-Räume, spezielle Diagnostik)
- Praxisorganisation und Teamgröße (Einzel- oder Gemeinschaftsnutzung)
- Arbeitsweise und Patientenstruktur (z. B. Integration digitaler Prozesse, Komfortansprüche)
Strategische Planung als Schlüssel zum Erfolg
Ein optimaler Praxisgrundriss entsteht durch strategische Planung, die alle relevanten Faktoren frühzeitig berücksichtigt:
Klare Zonierung und Wegeführung:
- Öffentlicher Bereich: Empfang mit großzügigen Pufferzonen, diskrete Patientensteuerung in Wartebereichen und Patienten-WCs.
- Übergangsbereiche: Labore und Kurzwartebereiche ermöglichen effiziente Abläufe.
- Geschützter medizinischer Bereich: Diskrete, störungsfreie Sprech- und Behandlungszimmer.
- Personal- und Verwaltungsbereiche: Klar getrennt zur Wahrung der organisatorischen Effizienz und Arbeitsruhe.
Gezielte Pufferzonen:
- Vor der Praxiseingangstür: Beispielhaft im Treppenhaus eines Gesundheitszentrums, um Warteschlangen und Diskretionsprobleme (insbesondere in Infektzeiten) zu vermeiden.
- Pufferzone vor dem Empfang: Ausreichend Stell- und Bewegungsflächen, besonders in Stoßzeiten. Idealerweise zwei vollwertige Arbeitsplätze am Empfang zur Trennung von ein- und ausgehenden Patientenströmen.
Experten-Vorteil: Erfahrung schafft Planungssicherheit
Viele Fehler und Herausforderungen in der Praxisplanung entstehen durch die Unterschätzung oder Nichtberücksichtigung vermeintlich kleiner Details. Genau hier ist die frühzeitige Einbindung einer erfahrenen und spezialisierten Beratung entscheidend:
- Frühzeitige Identifikation relevanter Vor- und Nachteile einer Planung
- Umfassende, objektive Bewertung verschiedener Planungsvarianten
- Transparente und fundierte Gegenüberstellung von Alternativen
- Sicherstellung aller baulichen, technischen und organisatorischen Anforderungen
- Vermittlung und Kommunikation zwischen medizinischen Bedürfnissen, baulichen Vorgaben und wirtschaftlichen Interessen
Gerade Ärzte, die ihre Anforderungen klar definieren wollen, sowie Architekten und Planer, denen spezifische Routine in der Planung medizinischer Einrichtungen fehlt, profitieren erheblich von diesem objektiven Expertenblick. Fehler und Risiken werden frühzeitig erkannt und können so kostspielige Nachbesserungen vermeiden helfen.
Fazit – Langfristig profitieren durch strategische Planung
Eine strukturierte, strategische und fachlich fundierte Planung sichert langfristig Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Zufriedenheit für medizinische Einrichtungen. Improvisierte Lösungen können langfristig hohe Folgekosten und organisatorische Herausforderungen verursachen. Eine ganzheitliche Betrachtung und strategische Planung hingegen stellt sicher, dass die Praxis nicht nur optimal startet, sondern langfristig erfolgreich bleibt.
Ihr nächster Schritt:
Ganz gleich, ob Sie Arzt sind und Unterstützung bei der klaren Definition Ihrer Anforderungen benötigen, oder Architekt/Planer, der Sicherheit durch unabhängige Expertise gewinnen möchte: Ich stehe Ihnen gern mit meiner langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise zur Seite.
Link-Empfehlungen zum Thema:
Interesse an einer Beratung? Hier geht’s zur unverbindlichen Erstberatung.





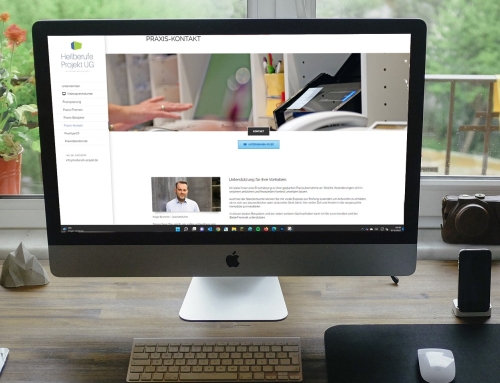





Sehr geehrte Damen und Herren,
es geht um einen Umzug in neue Räumlichkeiten einer Dermatologischen Praxis in NRW. Ich würde mich gerne informieren, ob Sie auch in NRW Praxen betreuen.
Mit freundlichem Gruß
Frau Dr. xxxxxxxxxxxxxxxx
Sehr geehrte Frau Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Können Sie uns bitte mitteilen, für welche Leistungen genau Sie Unterstützung wünschen?
Geht es Ihnen um:
• die Beratung
• Planung- und Errichtung der neuen Praxisräume
• den Praxisumzug
• die Praxiseinrichtung
• Ausstattung und Gestaltung
• oder die Überwachung und Koordinierung im allgemeinen?
Gern können wir hierzu auch telefonieren. Sie erreichen mich unter: +49 341 – 33 73 33 10
Unter dem folgenden Link finden Sie zahlreiche Ansprechpartner für Praxisplanung und Ausführung in Nordrhein-Westfalen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Holger Brummer
Sehr geehrter Herr Brummer,
mich würde interessieren, welche Verpflichtungen ein Vermieter bezüglich der Nutzung seiner Räumlichkeiten als Arztpraxis hat.
Welche Vorschriften muss er für die Elektroinstallation einhalten? Was bezüglich der Rettungswege und Brandschutz?
In der von mir übernommenen Praxis wurde seit 50 Jahren nicht renoviert, die Telefonkabel sind mit der Hand zusammengedreht. Was kann ich vom Vermieter aus arbeits- und versicherungstechnischen Gründen verlangen zu investieren?
Guten Tag,
ihre Anfrage zu entnehmen, möchten Sie gerne die Möglichkeiten prüfen und kennen lernen, die Sie ggf. gegenüber dem Vermieter als „seine Pflicht“ durchsetzen können. Grundsätzlich lässt sich hierzu sagen, dass wenn der Vermieter Ihnen die Räume als Arztpraxis vermietet, so müssen diese hierfür auch „geeignet sein“. Damit öffnet sich jedoch ein breites Feld an rechtlichen Aspekten, Vorschriften, Normen und Empfehlungen.
So etwas sollte bereits im Vorfeld einer Praxisübernahme geklärt werden.
Um ihnen dennoch Möglichkeiten aufzeigen zu können, welche Punkte und Aspekte Sie dem Vermieter entgegenbringen können, müsste zuerst eine Bestandsaufnahme (Anamnese) durchgeführt werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Holger Brummer
Guten Abend, können Sie mir sagen wo ich nachlesen kann, ob man als Heilmittelerbringer (Logopädie und Ergotherapie) explizit eine Praxisfläche mieten muss, oder ab eine Bürofläche ausreichend ist?
MfG
Hallo Frau Bessler,
vielen Dank für ihre Anfrage. Direkt nachlesen können Sie dies nicht. Eine Praxisfläche per se gibt es nicht, außer diese wurde baurechtlich als solche schon einmal genehmigt.
Eine „Gewerbefläche = Büro“ ist insofern ausreichend für den Betrieb einer Logopädie und Ergotherapie, wenn diese den verschieden gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien entspricht oder umgebaut wird.
Dabei spielen aus baurechtlicher Sicht viele Faktoren hinein:
• Fläche/ Größe der Nutzungseinheit
• Anzahl Beschäftigte
• Anzahl Patienten
• Gebäudeklasse
• Flucht- und Rettungswege
• Barrierefreiheit
• weiter Punkte, je nach örtlicher Situation und Aufgabenstellung
Vorgaben ergeben sich durch Zulassungsvoraussetzungen der GKV an die Anzahl, Art und Größe der notwendigen Funktionsbereiche = Therapieräume, Wartebereich, Toiletten etc. … zum Betrieb einer Logopädie und Ergotherapie.
Diese überschneiden sich in Teilen auch mit den Arbeitsstättenverordnung und Technische Regeln für Arbeitsstätten.
Wenn Sie ohne Praxispersonal arbeiten, erleichtert Sie dies bspw. um sonst notwendige Räume wie Personal-WC, Pausenraum, Umkleide usw. ….
Ein weiterer Aspekt ist, ob der Vermieter ihnen die Büroräume offiziell als Praxisräume vermietet. Wenn er dies tut, hat er auch dafür Sorge zu tragen, dass die Räumlichkeiten als solche auch genutzt werden dürfen.
Viele Grüße, Holger Brummer
Guten Tag, beim Grundriss, der oben auf dem Foto zu sehen ist, fällt mir eine Dusche auf. Für welche ambulanten medizinischen Einrichtungen ist eine Dusche vorgeschrieben? Danke!
Guten Tag,
eine Dusche ist in Arztpraxen gesetzlich nicht vorgeschrieben. Weder die Arbeitsstättenverordnung noch die Richtlinien des Robert Koch-Instituts erfordern das Vorhandensein einer Dusche in einer Arztpraxis. Die Entscheidung, ob eine Dusche bei der Planung einer Praxis berücksichtigt wird, liegt in der Verantwortung des Praxisbetreibers/in und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Spezialgebiet der Praxis oder dem Bedarf der Patienten.
Allerdings kann das Vorhandensein einer Dusche in bestimmten Fällen sinnvoll sein, wie beispielsweise in chirurgischen Praxen mit Bettenzimmern, in denen Patienten und Personal über Nacht in der Praxis verweilen. Hierbei kann sowohl eine Dusche im Bereich des Patienten-Bads vorgesehen werden, als auch eine separate Dusche für das Personal. In anderen Fällen hängt die Entscheidung ab, ob eine Dusche vorhanden sein sollte, von individuellen Faktoren ab und liegt in der Verantwortung des Praxisbetreibers/in.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Antwort weiterhelfen konnte. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.